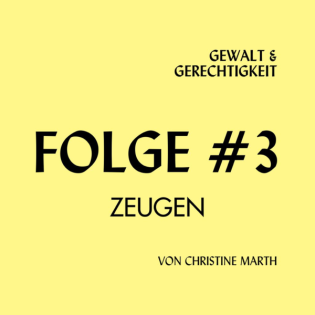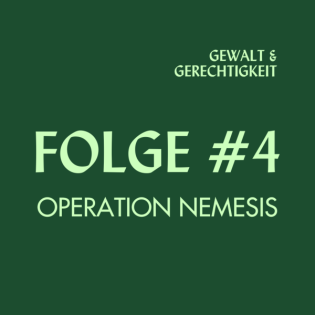Gewalt und Gerechtigkeit: Ein Hörspiel über den Mord an Talât Pascha
Der 15. März 1921 – ein Datum, das Geschichte schrieb. An diesem Tag fällt in Berlin ein Schuss, der weit mehr als nur ein Leben beendet. Er markiert einen Wendepunkt in der Auseinandersetzung mit Völkermord, Gerechtigkeit und internationaler Strafverfolgung. Das sechsteilige Hörspiel „Gewalt und Gerechtigkeit“ von Prof. Dr. Christin Pschichholz, Christine Marth und Ani Menua erzählt diese außergewöhnliche Geschichte.
Ein politischer Mord in Berlin
Talaat Pascha, ehemaliger Innenminister und Großwesir des Osmanischen Reichs, wird an diesem Frühlingstag 1921 in der Berliner Hardenbergstraße erschossen. Ein gezielter Schuss in den Hinterkopf beendet das Leben eines Mannes, der als einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord an den Armeniern gilt. Der Täter wird sofort gefasst – doch damit beginnt eine Geschichte, die Fragen aufwirft, die bis heute nichts von ihrer Brisanz verloren haben.
Sechs Episoden, eine Geschichte
Das Hörspiel-Projekt gliedert diese komplexe Geschichte in sechs eindringliche Episoden, die verschiedene Perspektiven und Zeitebenen miteinander verweben:
TEASER
TEASER | GEWALT & GERECHTIGKEIT
Worum geht es? Am Vormittag des 15. März 1921 in der
Hardenbergstraße in Berlin-Charlottenburg erschießt der Armenier
Soghomon Tehlirian den ehemaligen türkischen Großwesir Talaat
Pascha. War Rache sein Motiv?
Triggerwarnung: Der Podcast enthält Darstellungen von
Gewalt, die möglicherweise retraumatisieren oder zu intensiven
emotionalen Reaktionen führen können.
Folge 1 | DAS OPFER
Folge 1 | DAS OPFER
Ein spektakulärer Mord am 15.März 1921 in Berlin: Das Opfer ist Talaat Pascha. Er ist der ehemalige Innenminister und Großwesir des Osmanischen Reichs. Mit einem gezielten Schuss in den Hinterkopf wird er getötet, der Täter – schnell gefasst. Nun beginnt eine Geschichte über Gewalt und Gerechtigkeit. Sie nimmt uns zunächst mit in das spätosmanische Reich und schildert den steilen politischen Aufstieg des Machtmenschen Talaat.
Triggerwarnung: Der Podcast enthält Darstellungen von
Gewalt, die möglicherweise retraumatisieren oder zu intensiven
emotionalen Reaktionen führen können.
Folge 2 | EIN TÄTER & EIN MOTIV
Folge 2 | EIN TÄTER & EIN MOTIV
Der Mörder von Talât wird dem Haftrichter vorgeführt. Sein Name ist Soghomon Tehlirian. Er gibt sich als armenischer Student aus und beteuert immer wieder: „Ich habe einen Menschen getötet, aber ich bin kein Mörder”. Während des Strafprozesses gegen ihn überschlägt sich die Presse mit Spekulationen – ist das Motiv Rache? Rache für die Massaker an der armenischen Bevölkerung während des Ersten Weltkrieges? War der Mord etwa gerecht?
Triggerwarnung: Der Podcast enthält Darstellungen von
Gewalt, die möglicherweise retraumatisieren oder zu intensiven
emotionalen Reaktionen führen können.
Folge 3 | ZEUGEN
Folge 3 | ZEUGEN
Vor Gericht, im Juni 1921 geht es kaum um den Mord in der Hardenbergstraße, sondern fast ausschließlich um die Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs. Zahlreiche Zeugen, darunter Überlebende, bestätigen, dass Talaat der Hauptverantwortliche ist und dass viele Deutsche von den Massakern wissen. Doch was wird aus dem geständigen Angeklagten? Droht ihm die Todesstrafe?
Triggerwarnung: Der Podcast enthält Darstellungen von
Gewalt, die möglicherweise retraumatisieren oder zu intensiven
emotionalen Reaktionen führen können
Folge 4 | OPERATION NEMESIS
Folge 4 | OPERATION NEMESIS
Drei Staranwälte schaffen das scheinbar Unmögliche: Tehlirian, der Mörder Talaats, wird freigesprochen. Eine Sensation! Die Weltöffentlichkeit schaut nach Berlin. Erst später wird klar: Hier ist ein Geheimplan aufgegangen.
Triggerwarnung: Der Podcast enthält Darstellungen von
Gewalt, die möglicherweise retraumatisieren oder zu intensiven
emotionalen Reaktionen führen können.
Folge 5 | RACHE, RECHT, GERECHTIGKEIT
Folge 5 | RACHE, RECHT, GERECHTIGKEIT
Der Student Raphael Lemkin hört vom Prozess und fragt sich: Wie ist es möglich, dass sich ein Massenmörder wie Talaat nicht vor Gericht verantworten muss, sein Mörder aber schon? Er kämpft sein Leben lang für ein internationales Gesetz, um die Verantwortlichen von Massenmorden wie an der armenischen Bevölkerung zu bestrafen. Aber wie beschreibt man ein Verbrechen, für das es noch kein Wort gibt? Lemkin erfindet ein Wort: Genozid. Dieser Begriff bekommt eine enorme Bedeutung, besonders für die Opfer, die für die Anerkennung des eigenen Leids kämpfen.
Triggerwarnung: Der Podcast enthält Darstellungen von
Gewalt, die möglicherweise retraumatisieren oder zu intensiven
emotionalen Reaktionen führen können.
Folge 6 | ERINNERUNG
Folge 6 | ERINNERUNG
Die Erinnerung an Genozid ist wichtig und gleichzeitig schwierig. Das zeigt der Blick auf die Erinnerungskultur in Armenien und die Türkei. Und am Ende stehen viele Fragen: Kann die Vergangenheit verdrängt werden oder findet sie nicht immer wieder den Weg in die Gesellschaft? Nützt das Drängen auf Anerkennung des Genozids oder werden Konflikte dadurch nur größer? Oder ist es die Gewissensentscheidung eines jeden Menschen, die historischen Realitäten anzuerkennen?
Triggerwarnung: Der Podcast enthält Darstellungen von
Gewalt, die möglicherweise retraumatisieren oder zu intensiven
emotionalen Reaktionen führen können.
Alle Informationen zum Podcast finden Sie hier auch kompakt im Pressekit:
Von der Macht zum Mord: Talaats Aufstieg
Das Hörspiel zeichnet den Werdegang Talaat Paschas detailliert nach – vom einfachen Telegrafisten zum mächtigen Innenminister und schließlich Großwesir. Als führendes Mitglied der Jungtürken prägte er die Politik des untergehenden Osmanischen Reichs entscheidend mit.
Doch seine Amtszeit ist untrennbar verbunden mit einem der dunkelsten Kapitel der Geschichte: dem Völkermord an den Armeniern zwischen 1915 und 1917, dem bis zu 1,5 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Talaat Pascha gilt als Architekt dieser systematischen Vernichtungspolitik.
Der Berliner Prozess: Ein juristischer Wendepunkt
Der Prozess gegen Soghomon Tehlirian ist einer der spektakulärsten in der deutschen Rechtsgeschichte. Drei Staranwälte – darunter der renommierte Verteidiger Dr. Niemeyer – schaffen es, den Fokus von der Tat auf das Motiv zu verlagern. Der Gerichtssaal wird zum Forum für Zeugenaussagen über den Völkermord.
Die Verteidigungsstrategie ist revolutionär: Statt die Tat zu leugnen oder zu relativieren, wird Talaats Verantwortung für den Genozid ins Zentrum gerückt. Tehlirian wird als traumatisierter Überlebender dargestellt, der unter dem Einfluss seiner Erlebnisse handelte. Das Gericht spricht ihn frei – ein Urteil, das internationale Wellen schlägt.
Raphael Lemkin und die Geburt des Völkerstrafrechts
Raphael Lemkin war tief beeindruckt vom Berliner Prozess. Die Frage, warum Talaat nie vor Gericht gestellt wurde, während sein Mörder angeklagt war, ließ ihn nicht los. Lemkin erkannte: Es fehlte ein rechtlicher Rahmen, um Massenmorde an ethnischen oder religiösen Gruppen zu verfolgen.
Sein Lebenswerk war die Schaffung dieses Rahmens. Er prägte den Begriff „Genozid“ und kämpfte unermüdlich für dessen rechtliche Anerkennung. 1948 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes – maßgeblich durch Lemkins Arbeit inspiriert.
Künstlerische Umsetzung
Das Projekt von Prof. Dr. Christin Pschichholz, Christine Marth und Ani Menua verbindet dokumentarische Genauigkeit mit narrativer Kraft. Durch den Einsatz von:
- Archivmaterial und historischen Quellen aus der Zeit
- Szenischen Rekonstruktionen der Schlüsselmomente
- Multiplen Erzählperspektiven (Täter, Opfer, Richter, Zeitzeugen, Historiker)
- Atmosphärischem Sounddesign, das die verschiedenen Zeitebenen und Schauplätze voneinander trennt
- Mehrsprachigkeit (Deutsch, Türkisch, Armenisch) zur authentischen Darstellung
entsteht ein vielschichtiges Hörerlebnis, das Geschichte lebendig werden lässt.
Warum diese Geschichte heute relevant ist
Die Fragen, die „Gewalt und Gerechtigkeit“ aufwirft, sind von erschreckender Aktualität:
- Transitional Justice: Wie gehen Gesellschaften mit Massenverbrechen um?
- Internationale Strafgerichtsbarkeit: Welche Rolle spielt sie bei der Aufarbeitung von Völkermord?
- Individuelle versus kollektive Verantwortung: Wo liegen die Grenzen?
- Erinnerungskultur: Warum ist die Anerkennung von Leid so wichtig?
- Prävention: Kann das Völkerstrafrecht künftige Genozide verhindern?
Der Fall Talaat Pascha steht am Beginn einer Entwicklung, die zur Schaffung internationaler Strafgerichtshöfe führte. Der Berliner Prozess von 1921 kann als Vorläufer der Nürnberger Prozesse und des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag gesehen werden.
Die Macht der Anerkennung
Das Hörspiel zeigt auch, welche immense Bedeutung die Anerkennung von Leid für die Opfer und ihre Nachkommen hat. Der Kampf um die Anerkennung des Völkermords an den Armeniern dauert bis heute an. Die Türkei leugnet weiterhin offiziell, dass es sich um einen Genozid gehandelt hat – trotz der überwältigenden historischen Evidenz.
Die Erfindung des Wortes „Genozid“ durch Raphael Lemkin gab den Opfern eine Sprache für ihr Leid. Es schuf einen rechtlichen Rahmen, der künftige Verbrechen verhindern und bestrafen sollte. Der Begriff wurde zum Werkzeug der Anerkennung und der Gerechtigkeit.
Ein Projekt der historischen Bildung
Das sechsteilige Hörspiel macht komplexe historische Zusammenhänge durch seine narrative Kraft erlebbar und lädt zur Reflexion ein. Es schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart und zeigt, wie historische Ereignisse bis heute nachwirken.
Die Geschichte von Talaat Pascha, Soghomon Tehlirian und Raphael Lemkin ist mehr als ein Kriminalfall – sie ist eine Auseinandersetzung mit den fundamentalen Fragen menschlichen Zusammenlebens:
- Was ist Gerechtigkeit?
- Kann Unrecht je gesühnt werden?
- Wie kann eine Gesellschaft mit kollektiver Schuld umgehen?
- Welche Macht haben Worte, um Verbrechen zu benennen und zu verhindern?
- Wo endet legitime Vergeltung und beginnt neues Unrecht?
Diese Fragen haben nichts von ihrer Dringlichkeit verloren – im Gegenteil, sie stellen sich in unserer globalisierten Welt mit noch größerer Schärfe.
Für wen ist dieses Hörspiel?
„Gewalt und Gerechtigkeit“ richtet sich an alle, die sich für Geschichte, Recht und ethische Fragen interessieren:
- Geschichtsinteressierte, die mehr über das späte Osmanische Reich und den Völkermord an den Armeniern erfahren möchten
- Studierende der Geschichte, Rechtswissenschaften und Politikwissenschaft
- Menschen mit Bezug zur deutsch-türkischen und armenischen Geschichte
- Alle, die sich mit Fragen von Transitional Justice, Versöhnung und Erinnerungskultur beschäftigen
- Juristen, die an der Entwicklung des Völkerstrafrechts interessiert sind
- Pädagogen, die historische Bildungsarbeit leisten
Das Projekt wurde durch die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert.