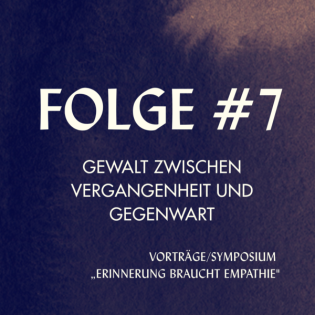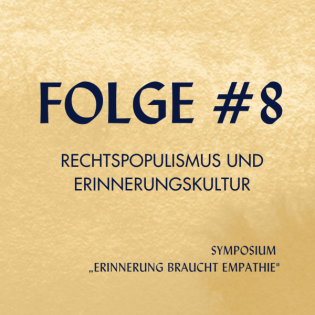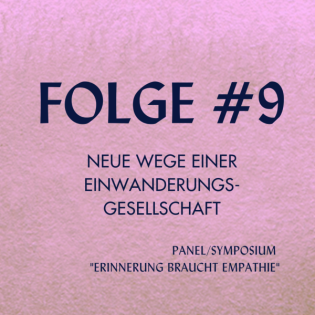Multiperspektivische Auseinandersetzung mit historischer Massengewalt
In einer zunehmend diversen Gesellschaft stellt sich die Frage: Wie gestalten wir eine inklusive Erinnerungskultur, die unterschiedliche historische Erfahrungen würdigt, ohne Opferhierarchien zu schaffen?
Das Projekt im Überblick
Das Symposium „Erinnerung braucht Empathie“ widmet sich dem Genozid an der armenischen Bevölkerung 1915/16 und dessen Nachwirkungen in der postmigrantischen Gesellschaft Deutschlands. Durch eine dreiteilige Veranstaltungsreihe werden komplexe Erinnerungskonflikte niederschwellig aufbereitet.
Bildungspolitische Relevanz
Das Projekt schließt eine bedeutende Leerstelle in der politischen Bildung: Die kritische Auseinandersetzung mit nicht-europäischen Genoziden und deren Verflechtung mit europäischer Geschichte. Es demonstriert, dass Erinnerungsarbeit ein kontinuierlicher, gesellschaftlicher Aushandlungsprozess ist – essentiell für demokratische Resilienz.
Hier finden Sie das gesamte Programm des Symposiums zum Download (PDF):
Dokumentation
Folge 7 | GEWALT ZWISCHEN VERGANGENHEIT UND GEGENWART
Zwei Einführungsvorträge und zwei Panels thematisierten Erinnerunskultur
und -politik aus unterschiedlichen Blickwinkeln: Warum ist es notwendig, kollektive Gewalt gesellschaftspolitisch anzuerkennen?
Und wie können verschiedene Gewaltgeschichten Teil einer postmigrantischen
Erinnerungskultur werden?
Dr. Christin Pschichholz spricht in ihrem Vortrag über „Der Genozid an den
Armenierinnen und die postmigrantische Gesellschaft in Deutschland“ – und fragt,
wie vielfältige Erinnerung in Deutschland möglich ist.
Dr. Arpine Maniero beleuchtet unter dem Titel „Einfach nur ein Genozid“ die aktuellen
Gewaltkontinuitäten in Berg-Karabach (Artsakh) – und macht auf Deutschlands
blinde Flecken in der Außen- und Erinnerungspolitik aufmerksam.
Folge 8 | RECHTSPOPULISMUS UND ERINNERUNGSKULTUR
Wie können Erinnerungskulturen nebeneinander bestehen – ohne Konkurrenz, ohne Ausschluss? Was passiert, wenn postmigrantische Communitys sich gegen rechte Vereinnahmung wehren?
In diesem Panel „Die Wirkung von antidemokratische Bewegungen und Rechtspopulismus auf Erinnerungskultur und ihre Folgen” diskutieren Julia Boxler, Dr. Darja Klingenberg und Dr. Dastan Jasim in der Moderation von Daniel Heinz über antidemokratische Bewegungen, rechte Rhetorik und darüber, warum eine kritische, plurale Erinnerungskultur keine Option, sondern eine Notwendigkeit für eine offene Gesellschaft ist.
Folge 9 | NEUE WEGE EINER EINWANDERUNGSGESELLSCHAFT
Welche Rolle spielt Kunst im politischen Gedenken? Wie entfaltet Lyrik ihre Wirkung im Widerstand gegen rassistische Gewalt und historische Auslassung?
Im Panel „Brauchen wir noch mehr Erinnerung in Deutschland? Neue Wege einer Einwanderungsgesellschaft“ sprechen die Lyrikerin Elona Beqiraj, Dr. Veronika Zablotsky und Prof. Dr. Burak Çopur mit Ani Menua über das Spannungsverhältnis von Literatur, Kunst und politischer Theorie.
Dabei geht es nicht um die bloße Illustration politischer Themen – sondern um Kunst als aktiven Bestandteil einer widerständigen Erinnerungspraxis.
Alle Informationen zum Podcast finden Sie hier auch kompakt im Pressekit:
Das Projekt wurde durch die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert.